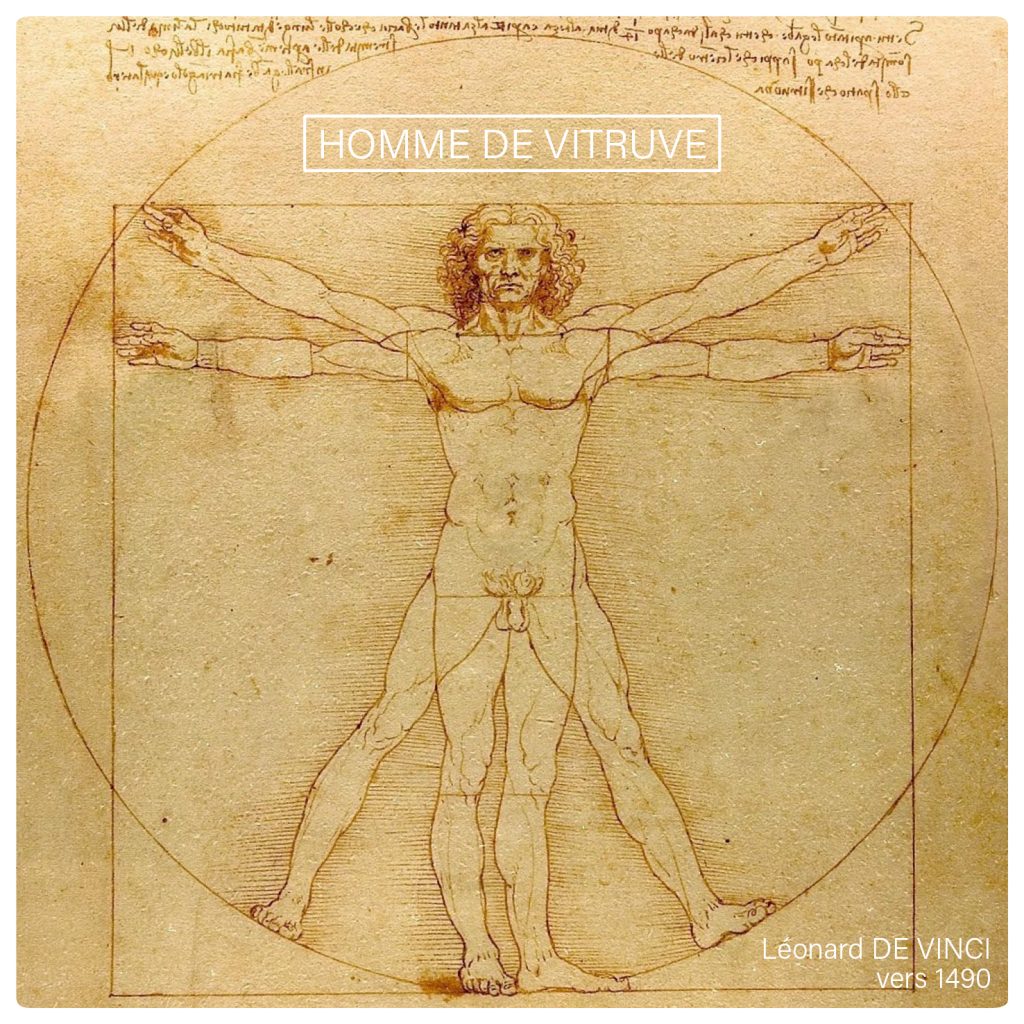
Alle Jahre wieder versammelt sich das erlauchte Festspielpublikum sommers bei den kulturellen Leuchttürmen der Republik in Bregenz und Salzburg, um der Kunst und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ihre Referenz zu erweisen. Klarerweise dürfen die Repräsentanten des gesellschaftlichen und politischen Lebens nicht fehlen, um mit grossen Worten dem Profanen die Aura des Heiligen zu verleihen, wie in diesem Jahr mit der tiefschürfenden Exegese von „Normalität“ durch die politischen Hohepriester der Republik.
Der einfachen chemischen Definition von Normalität als Konzentration einer bestimmten Stoffmenge und ihrer Wertigkeit entzieht sich jene Definition psychologischer Normalität, die erwünschtes Verhalten als Gegensatz zu unerwünschtem, gestörtem Verhalten definiert, oder gar jene gesellschaftliche Normalität, über die gar nicht mehr verhandelt werden muss, weil die Normen durch jahrzehntelange Erziehung bereits präformiert wurden, die sogenannte präfaschistoide Schnitzel-Normalität der normal denkenden breiten Mitte der Bevölkerung.
Manchmal bestimmt auch das Gegenteil, das Anormale, Merkwürdige, Verrückte, Bizarre, die Normalität des Gesellschaftlichen wie in den pandemischen Zeiten der Grundrechtseingriffe, Denunziationen, der steigenden Preise, der Wohlstandsverluste, des verschwenderischen Irrsinns, wie manche Theoretiker der „zerbrochenen Fenster“ wissen, die lieber über Populismus schwadronieren, statt mit der beklagten Ernsthaftigkeit an der Beseitigung der von ihnen verursachten Probleme zu arbeiten, um zerbrochene Fenster zu verhindern.
Kunst macht sich übrigens nicht mit jener Normalität der normal „Denkenden“ gemein, denen Künstler*innen ohnehin a priori verdächtig sind, wie der grauenhafte Umgang der zahlreichen Mitläufer*innen in der völkischen Mitte mit dem Nicht-Normalen, Entarteten nicht nur in der Vergangenheit zeigt. Den Bann zu brechen mittels hellen Bewusstseins wäre Aufgabe von Aufklärung, die die Demokratie bedrohenden Ressentiments als Erbe primitiven Stammesdenkens zu überwinden durch Reflexion über sich selbst und die anderen, damit die Bereitschaft zum Unsäglichen nicht fortwese in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammerten, wie es Theodor Adorno einst formulierte.
Ach ja, apropos Kulturpolitik: „Denn es gibt das Gute, das Schöne, das Gemeinsame. Und die Bregenzer Festspiele zeigen das“, meinte das Staatsoberhaupt richtigerweise.
Und sonst war da nichts?
